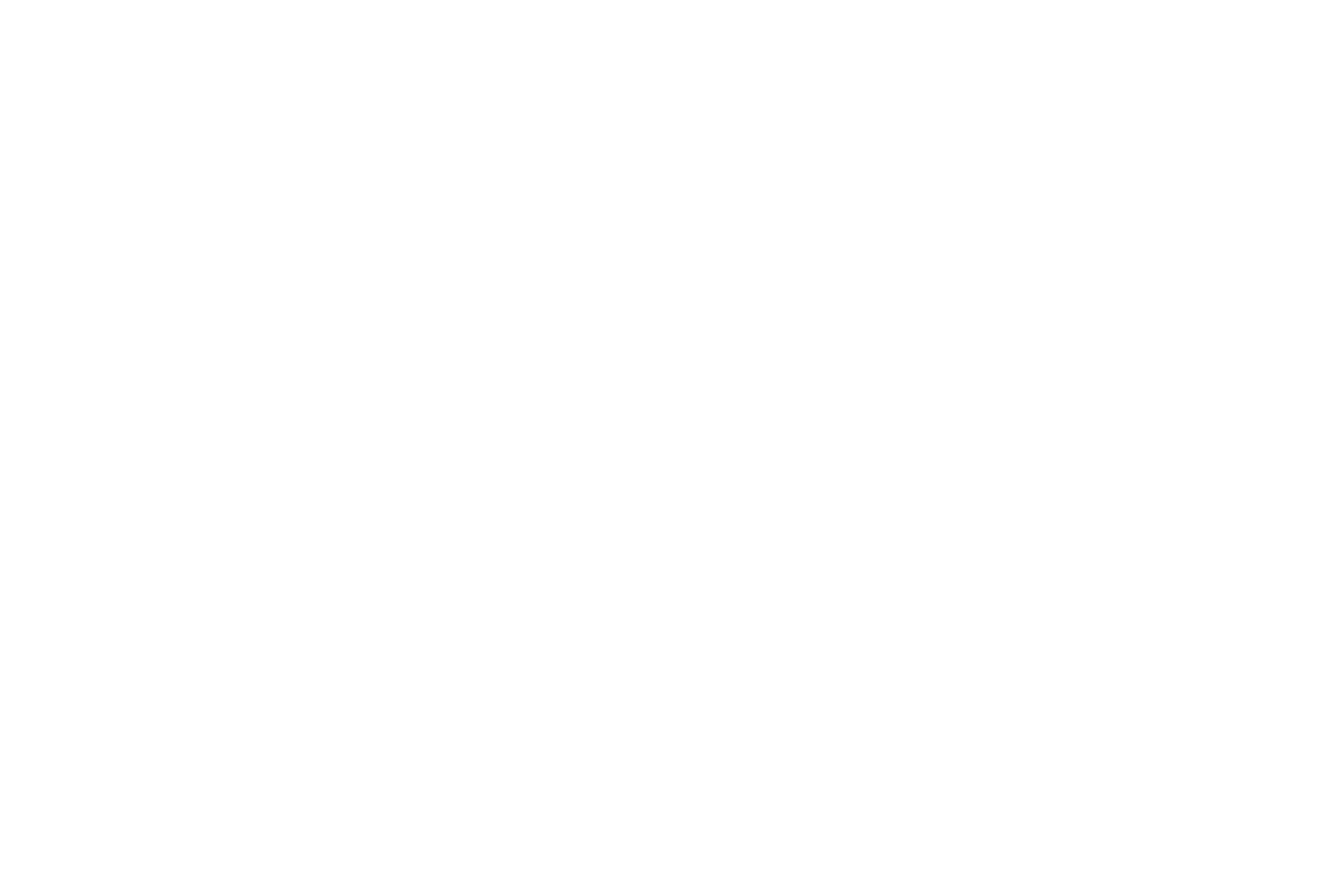Manchmal sind es die eigentlich beiläufigen Bemerkungen, die einen aufhorchen lassen. So auch vor einigen Wochen bei der Lektüre eines Artikels im Guardian zu den düsteren Aussichten für den deutschen Einzelhandel. Für ihre englischsprachigen, vorwiegend in Großbritannien ansässigen Leser berichtet die Berlin-Korrespondentin der Zeitung über den exorbitanten Frequenzrückgang, das drohende Ladensterben und den nicht so ganz zu Ende gedachten Vorstoß des Wirtschaftsministers, einen verbindlichen Einheitspreis für ein und dasselbe Hemd einzuführen – egal ob vom Hersteller oder vom Händler gekauft, ob mit Online- oder stationärer Kostenstruktur vermarktet.
Das sind ja für deutsche Leser keine so neuen Themen. Aber es ist immer interessant, mal eine andere Perspektive einzunehmen und die eigene Realität von außen zu betrachten. Und dann springt einem sofort folgender Satz ins Auge:
„But Altmaier’s plan – to “digitise” local shops’ relationships with their customers to allow them to better compete with online retailers – speaks to a quirk of the German high street. Cash is still king in many places, credit cards are often not accepted in smaller shops and many retailers do not have websites.“
Übersetzt: „Das Vorhaben von Altmaier soll die Beziehungen zwischen den örtlichen Geschäften und ihren Kunden ‚digitalisieren‘ und sie so in die Lage versetzen, es besser mit Online-Händlern aufzunehmen – was mit den Marotten des stationären Einzelhandels in Deutschland zu tun hat. Denn vielerorts gilt nach wie vor die Devise, dass nur Bares Wahres ist. Vor allem in kleineren Läden werden Kreditkarten oft nicht akzeptiert und vielen Händlern fehlt eine Webseite.“
Daran, was die Redakteurin ihren Lesern im Ausland erklären muss, sieht man, was hier anders ist. Die ständige Unsicherheit, ob man genug Bargeld dabei hat und ob dieser oder jener Laden Kredit-, nur EC- oder keinerlei Karte als Zahlungsmethode annimmt, kennen Briten nämlich gar nicht mehr. Diejenigen, die nach 1990 geboren sind, haben sie erst gar nicht erlebt. Bis die Millennials Ende der 2000er ihre ersten Bankkonten bekamen, gab es schon in jedem Kiosk Kartenlesegeräte und London Transport machte sich bereits daran, Bargeld komplett aus den berühmten roten doppelstöckigen Bussen zu verbannen. Schon die Generation davor bekam in den 1990ern zum Wechsel an die Universität ungefragt eine Kreditkarte von ihren Banken.
Nun: Ob es so eine gute Idee war, britischen Erstsemester eine Kreditkarte in die Hand zu drücken und die Zahlung damit in Kneipen zu ermöglichen, lasse ich dahingestellt. Worübe ich mir aber ziemlich sicher bin: Deutsche Einzelhändler, die Warenkorbwerte im dreistelligen Bereich erzielen wollen, aber immer noch keine Kreditkartenzahlung akzeptieren, tun sich damit keinen Gefallen. Nicht primär, weil das Ausländer nicht verstehen (was aber in einigen Trendvierteln in Berlin tatsächlich zum Problem werden könnte!). Sondern vor allem deswegen, weil auch Deutsche mittlerweile Kreditkarten haben und nutzen wollen.
Denn ständig heißt es im Einzelhandel: „Wir tun dies/Wir unterlassen das, weil der Kunde das so will bzw. so nicht will.“ Daran kann man getrost zweifeln, wenn man Folgendes liest: Anfang 2019 ergab eine vom Institut für Handelsforschung durchgeführte repräsentative Umfrage von beinahe 60.000 Innenstadtbesuchern, dass sie den Stadtzentren hierzulande einen Notendurchschnitt von lediglich 3+ erteilen. Das heißt: Noch vor Corona und gar unter den Leuten, die sich schon die Mühe gemacht hatten, überhaupt in die Stadt zu fahren, schnitten die Einkaufsstraßen schlecht ab. Das hört sich nicht gerade nach erfolgreicher Kundenorientierung an.
Diese Umfrage wird beim Guardian erwähnt – sowie die Tatsache, dass hierzulande so Sachen wie „Click & Collect“ oder E-Food vergleichsweise selten angeboten werden. Auch das ist also erklärungsbedürftig aus Sicht des britischen Lesers. Klar: Großbritannien ist das Land, in dem es mit Ocado bereits zur Jahrtausendwende einen Online-Pure-Play-Supermarkt gab. Davon gibt es in Deutschland gerade eine Handvoll – wovon einer der erfolgreichsten, Picnic, wiederum aus den Niederlanden stammt. Derweil haben einige deutsche Supermarktketten komplette Online-Filialen aufgebaut, um sie dann wieder einzustampfen. All das kann man etwa den sehr unterhaltsamen E-Food Podcasts vom Kollegen Alex Graf mit Branchenkenner Udo Kiesslich entnehmen.
Damit will ich jetzt nicht die übliche „Digitalwüste Deutschland!“-Leier anstimmen. Hier gibt es auch stark wachsende Unternehmen wie Flaschenpost, das gerade für sage und schreibe eine Milliarde Euro von der Oetker-Gruppe gekauft wurde und das das deutscheste aller Lebensmittelsegmente digitalisiert: Bier und Sprudelwasser. (Übrigens: Wenn der Guardian mal über die Firma berichtet, wird die Redakteurin den Briten erklären müssen, dass Deutsche Getränke in Kisten einkaufen und beinahe allergisch auf Leitungswasser reagieren.) Bloß: Andere Länder sind da schon weiter. Nicht „anders“ übrigens, weil die Entwicklung in allen westlichen Konsumgesellschaften gleich verläuft: Weniger Bargeld, weniger Einkaufsbummler in den Innenstädten und mehr Online-Handel. Nur verlief diese Entwicklung eben langsamer ab bei uns – bislang. Die Corona-Krise sorgt hier gerade für eine rasche Anpassung an die Verhältnisse, die bereits anderswo herrschen.
Wer übrigens in den letzten Jahren in einer der traurigen britischen Fußgängerzonen unterwegs war, in denen bereits die Tauben den Einkäufern in der Überzahl sind und die immer gleichen Läden mit ihren „Click & Collect Point Here“-Schildern und „Card only“-Kassen, hat übrigens einen Blick der deutschen Innenstadt anno 2021 erhascht.