Das muss das Ende sein. Das dachte ich jedenfalls damals im Juni 2009, als Karstadt-Arcandor Insolvenz beantragte. Es fühlte sich eben nach Zeitenwende an. Seit Jahren schon liefen die Kunden unübersehbar zu Discountern, Filialisten und zunehmend zu Amazon sowie zum damals noch jungen Zalando über. Die Trauer über das Verschwinden von diesem „Eckpfeiler der deutschen Handelslandschaft“ konnte ich persönlich zwar nicht teilen, aber seitens der Beschäftigten – und der Rentner, die irgendwie nichts besseres mit ihrer freien Zeit anzufangen wussten, als sich schon um neun Uhr vor den noch verschlossenen Türen der Konsumtempel zu versammeln – immerhin nachvollziehen.
Die Wiederholung des Immergleichen
Doch irgendwie lebte Karstadt weiter. Und irgendwie brauchte sich mein Verständnis für die Beschäftigten und die immer weniger werdenden Kunden des Unternehmens mit jedem Doch-Nicht-Ende ein Stück weiter auf. Zumal diese Enden immer häufiger – und daher immer langweiliger, weil immer absehbarer und immer repetitiver – wurden. Dank Polit-Aktionismus, dauerhaft-bis-nervtötender gewerkschaftlicher Medienbeschallung und, gelinde gesagt, problematischen Retter-in-der-Not-Figuren à la Berggruen und Benko, entkam die todgeweihte Warenhauskette nämlich immer wieder dem Sensenmann. (Auf die Chronologie ging ich hier bereits länger ein.) Und selbst als alle Therapieoptionen dann wirklich ausgereizt waren und das Ende des Unternehmens unumgänglich war, gab es den Löffel einfach immer noch nicht ab – sondern warf ihn neben den von Galeria-Kaufhof in die Schüssel. Spätestens da hatte ich kein Mitleid mehr: Wer als Arbeitnehmer noch dort beschäftigt oder als Investor dort beteiligt ist, hat genug Gelegenheit gehabt, festzustellen, was die Glocke schlägt.
Ja, die Leidensfähigkeit der Beschäftigten, der Gewerkschaftsaktivisten und nicht zuletzt der Investoren verlangte einem eigentlich Respekt ab, wenn sie nicht mittlerweile so furchtbar offenkundig umsonst wäre. Ich habe schon Respekt vor jemanden, der für eine Causa brennt, selbst wenn ich sie nicht teile. Mir waren Warenhäuser zwar immer egal, anderen waren sie aber wichtig. Sollen sie doch versuchen, sie zu erhalten. Nur: Die Grenze zwischen engagiert und borniert, zwischen Idealist und Fantasist ist fließend. Diese immer neuen Aufrufe, „Karstadt zu retten“ weil „die Zukunft der Innenstädte auf dem Spiel steht“ und „Begegnungsstätten verloren zugehen drohen“… Das ist doch nicht mehr ernst zu nehmen. Man kann, man muss für das kämpfen, woran man glaubt. Man muss aber eben auch den Punkt erkennen, an dem der noble Glaube in schlichte Realitätsverweigerung umschlägt.
Zu nichts anderem übrigens rate ich Gründern in der Digitalwirtschaft, die drei-, vier- oder fünfmal mit bis zum Verwechseln ähnlich bescheuerten Konzepten auf die Nase gefallen sind und immer noch nicht einsehen wollen, dass sie eben nicht das nächste Zalando am Start haben. Denn oft wird Kritik von meiner Zunft am mittlerweile krankhaften Festhalten an alten stationären Strukturen damit abgetan, dass wir Digitalberater mit zweierlei Maßstab messen und jungen Unternehmern das allzu bereitwillig verzeihen würden, wessen wir anderen bezichtigen, wenn sie sich nur hartnäckig genug als „start-up entrepreneur“ schimpfen.
Staatshilfe: Eine Menge Heu für ein totes Pferd
Dem Bund würde ich jedenfalls dazu raten, keine 460 Millionen Euro Steuergeld (WELT) in eine Struktur zu stecken, die nicht mehr nur vor dem Aus, sondern bereits ein gutes Stück danach steht. Auf die genauen Gründe brauche ich nicht – oder: sollte ich nicht mehr brauchen – einzugehen. Ich glaube, es sagt alles, dass sich die Monopolkommission nicht deswegen einschaltet, weil die letzte verbliebene Warenhauskette zu einem Monopolist zu werden droht: Sie ist ja ein Monopolist, aber in einem Marktsegment, das zu unbedeutend ist, um aus Sicht der Kommission eine Gefahr der Wettbewerbsverzerrung darzustellen. Nein, die Monopolkommission rügt, dass das Darlehen nachrangig gestaltet sein soll. So deren Präsidenten Kühling im verlinkten Artikel: „Im Insolvenzfall besteht kaum eine Chance auf Rückzahlung.“ Das hat der Mann sehr vorsichtig formuliert. Ich würde es so sagen: „Beim demnächst wahrscheinlich anstehenden Insolvenzverfahren werden 460 Millionen Euro Steuergeld für immer verschwunden sein.“
Eine Menge Heu also für ein totes Pferd, das so oder so zum Sterben verurteilt ist. Denn Corona ist hier bloß der Beschleuniger, aber keineswegs der Verursacher des fortgesetzten Verfalls. Der Versuch, die Pandemie als Feigenblatt für Subventionen zu benutzen, ist eklatant durchschaubar. Man muss nur den Plausibilitätstest machen: Wir schließen die Augen und versetzen uns ins Jahr 2025. Sehen wir da Trauben von Menschen vorm Karstadthof-Eingang, die darauf brennen, um 9:30 Uhr reingelassen zu werden, um dann eine halbe Stunde darauf zu warten, dass ihnen eine gehetzte Verkäuferin die Vorzüge einer Fissler-Pfanne erklärt – oder warte, war das nicht doch eine von WMF…?
Alles hat ein Ende…
460 Millionen Euro! Dabei haben wir hier städtische Theater und Schwimmbadbetreiber, die auf dem Zahnfleisch kriechen. Da sollte man das Steuergeld viel eher reinstecken. Da ist es zwar genauso weg, wie wenn wir es Kaleriastadthof (oder wie auch immer es nach der nächsten Restrukturierung heißt) geben. Nur: Theater und Thermen werden 2025 noch aktuell sein. Noch in hundert, vermutlich in tausend Jahren werden die Menschen sie noch aufsuchen. Sie hat es ja seit der Antike gegeben. In einigen griechischen Halbkreisen werden heute noch vor Publikum Tragödien aufgeführt – dieselben, ewigen Geschichten, die von todgeweihten Helden erzählen, die gegen das Unausweichliche ankämpfen und daran zugrunde gehen. Das ist ja das Wesen der Tragödie nach antikem Muster – und mittlerweile das Wesen der Warenhausgeschichte.
Und jetzt muss – trotz der (mittlerweile relativ wenigen) Arbeitsplätze, trotz der (immer realitätsfernerer) Innenstadt-Belebungsfolklore – eben mit dieser Geschichte ein und für allemal Schluss sein. Denn sonst findet sie kein Ende. Nur Enden, von denen es schon viel zu viele gab.
[…] Dinge, die wir fördern können, als das.“ So tragisch das für einzelne Arbeitnehmer sei: Mit immer weiteren Hilfen baue man hier eine Brücke ins Nirgendwo – wozu Alex eine passende Simsons-Szene einfällt. Wann […]

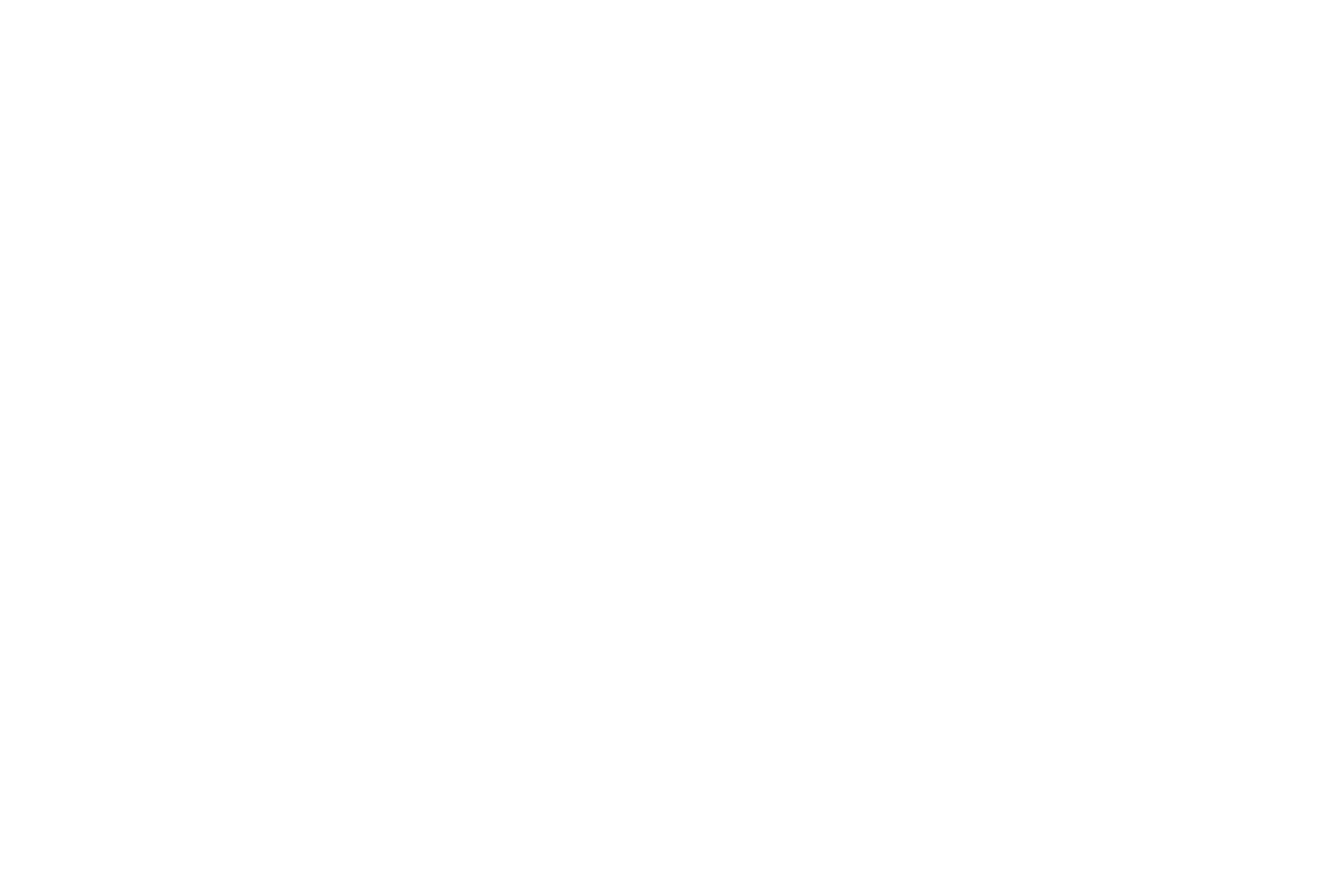



Dem ist nichts hinzuzufügen.Die betroffenen Standorte / Städte werden Druck machen und das tote Pferd weiter reiten lassen wollen…