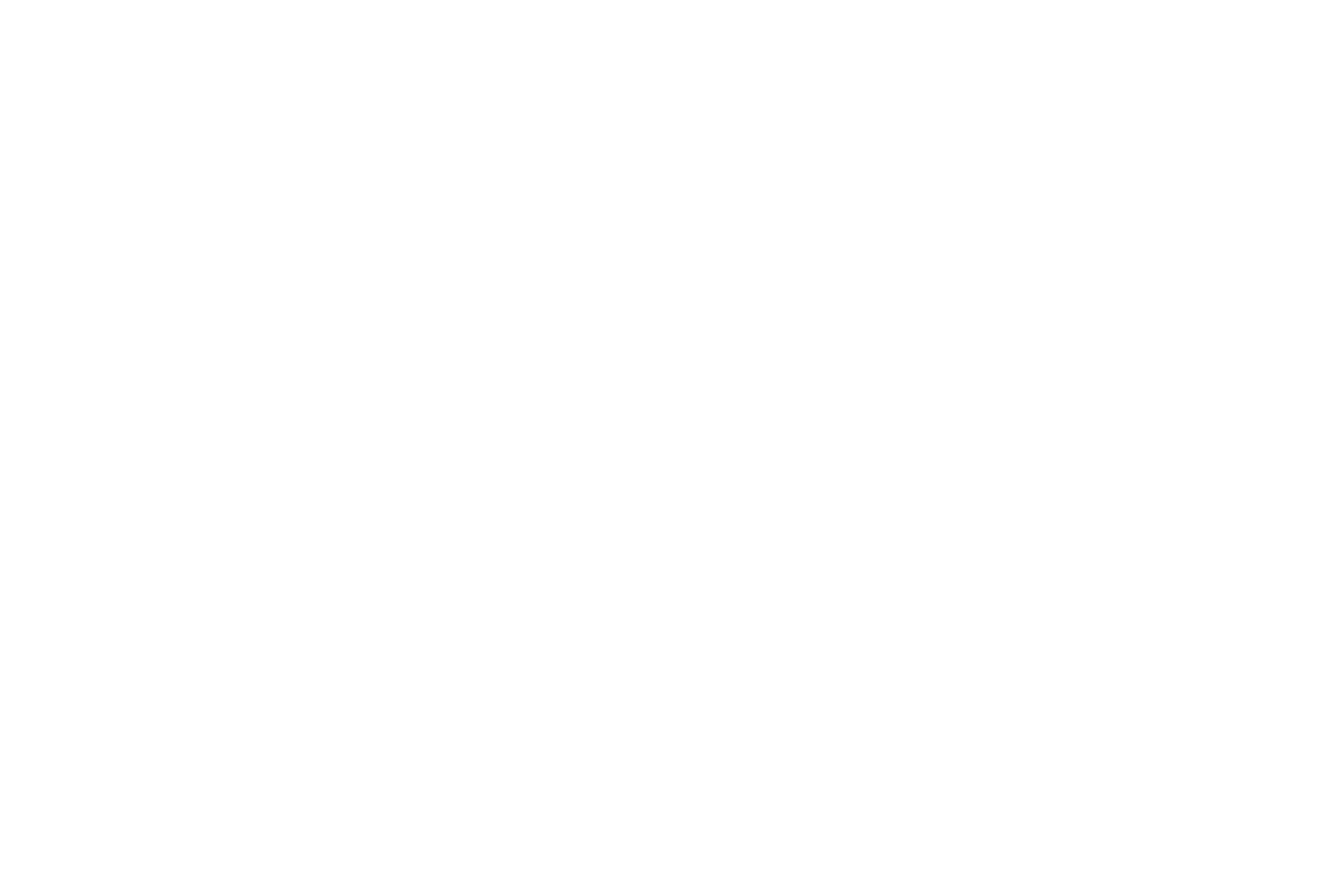(Copyright: Woithe)
Die deutsche Digitalpolitik muss vom Etikettenschwindel zur Exzellenz geführt werden, sonst nimmt der Bedeutungsverlust seinen Lauf. Lange wurde auf ein Digitalministerium hingefiebert – was lässt sich nach 100 Tagen sagen?
– Der Beitrag erschien in ähnlicher Form, etwas gekürzt, bereits bei The Pioneer. –
Mit dem neuen Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) soll die seit Jahren stockende Digitalisierung in Staat und Wirtschaft beschleunigt werden. Karsten Wildberger, der als Parteiloser angeheuert wurde und mittlerweile CDU-Mitglied ist, ist Deutschlands erster Bundesdigitalminister. Er versprach zum Amtsantritt ein „Digitales Next Germany“ und betonte, man werde „endlich in die Umsetzung kommen“ statt weiter zu zaudern.
Hohe Erwartungen an das neue Digitalministerium: „Damit endlich alles besser wird“!?
Die Einrichtung eines eigenständigen Digital-Ressorts zum Mai 2025 erfüllte eine zentrale Forderung von Verbänden und vielen Tech-Experten. „Endlich ein Ministerium für Digitales, endlich eins für Staatsmodernisierung“, mit diesen Worten eröffnete Wildberger seine erste Bundestagsrede. Die Vorschusslorbeeren waren groß: Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst begrüßte das neue Ressort als „Meilenstein für Deutschland“. Er mahnte aber zugleich, es könne nur zum Treiber der Digitalisierung werden, wenn klare Zuständigkeiten, Koordinationsrechte und ein eigener Etat sichergestellt sind. Kleine Vorwegnahme: Danach sieht es bisher noch nicht aus. Und ehrlicherweise ist ein Digitalministerium per se noch lange kein Heilsbringer, zumal Digitalisierung ein Querschnittsprozess in allen Ministerien sein müsste, den ein Vertical allein nicht für alle stemmen kann. Im Unternehmen nicht, im Staate – zumal der geprägt ist vom Föderalismus und viele Entscheidungsebenen – nicht.
Die Messlatte liegt hoch, denn Deutschlands digitalpolitischer Rückstand ist eklatant – die letzte Bundesregierung brachte von 334 Digitalvorhaben weniger als 40 Prozent zum Abschluss. Entsprechend riesig sind die Erwartungen aus Wirtschaft und Gesellschaft an Wildberger, den Ex-Manager der MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy (die mittlerweile auf vor einem Verkauf an die chinesische Plattform JDcom steht, aber das ist eine andere Geschichte). Dort hat er mit allen Schmerzen des digitalen Wandels gerungen. Seine Gestaltungsfreiheit beim Konzern war beschränkt, entsprechend ernüchternd sind die Fortschritte des Konzerns im Digitalen gewesen.
Wildbergers neuer Auftrag im Politikbetrieb gleicht einer Mammutaufgabe: Deutschlands Verwaltung ins digitale Zeitalter katapultieren, die Netzinfrastruktur modernisieren und die Wirtschaft für KI & Co. fit machen – und zwar zügig. Wildberger selbst dämpfte überzogene Hoffnungen: „Für Digitalisierung gibt es keinen Schalter, den man einfach umlegt. Digitalisierung ist ein Prozess“, warnte er im Bundestag. Doch nach Jahren des Stillstands wächst der Druck, greifbare Ergebnisse zu liefern. Schließlich wurde das BMDS von Kanzler Merz explizit geschaffen, „damit endlich alles besser wird“.
Erste Erfolge nach 100 Tagen
Trotz schwieriger Startbedingungen – das neue Ministerium musste provisorisch in bestehenden Räumen unterkommen, zu Beginn fehlten selbst Tassen und Kaffeemaschinen und Mitarbeitende brachten eigenes Geschirr mit – kann Wildbergers Haus nach 100 Tagen einige Etappenerfolge vorweisen (und auch weitere Büroräume wurden auf der Friedrichstraße gefunden!):
- Turbo für den Netzausbau: Gleich in den ersten Wochen setzte Wildberger ein machtvolles Signal beim Breitbandausbau. Auf Initiative des BMDS wurde der Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen per Gesetz zum „überragenden öffentlichen Interesse“ erklärt. Diese Änderung des Telekommunikationsgesetzes trat bereits Ende Juli in Kraft und bedeutet, dass Ausbauprojekte nun in Genehmigungsverfahren Vorrang genießen. Nach Jahren zäher Debatten wird damit Bürokratie abgebaut und Tempo beim Netzausbau gemacht. Das Ziel ist ehrgeizig: Bis 2030 soll flächendeckend Gigabit-Netz stehen. Der schnelle Gesetzescoup zeigt: Der Digitalminister kann liefern, zumindest was rechtliche Weichenstellungen angeht.
- Mobilfunk-Offensive: Parallel nahm Wildberger die Funklöcher und 5G-Lücken ins Visier. Bereits Ende Mai startete die Aktion #CheckDeinNetz, die erste bundesweite Mobilfunk-Messwoche. Bürger konnten per App Netzabdeckung messen; knapp 200 Millionen Messpunkte kamen zusammen. Ergebnis: Komplette Funklöcher (unter 1 Prozent) gibt es fast nicht mehr, aber nur etwa 48 Prozent der Menschen nutzen 5G, die Mehrheit (über 50 Prozent) hängt im alten 4G-Netz fest. Diese Transparenz untermauert den Handlungsbedarf beim 5G-Ausbau. Die Kampagne war ein cleverer Schachzug: Sie band die Bürgerinnen und Bürger ein – die meiner Meinung nach wichtigsten Verbündeten des BMDS! – und lieferte belastbare Daten, mit denen Wildberger politischen Druck für den Netzausbau machen kann. Die Digitalwirtschaft, allen voran die Telcos, dürften zufrieden sein, dass ihr Hilferuf bezüglich des schleppenden Mobilfunkausbaus Gehör findet.
- Verwaltungsdigitalisierung und „Once Only“: Im Bereich E-Government wurden wichtige Grundlagen gelegt. Das Bundeskabinett beschloss schon am 28. Mai die rechtliche Basis für das Once-Only-Prinzip. Kern ist das Nationale Once-Only-Tech-System (NOOTS) – eine Datenautobahn, die Ämter vernetzt, sodass Bürger und Unternehmen „Daten bei Behörden nur noch einmal angeben müssen“. Dieses Mammutprojekt der Registermodernisierung, von der Vorgängerregierung Ende 2024 vorbereitet, brachte Wildberger sofort auf den Weg. Das Gesetzgebungsverfahren zur Ratifizierung des NOOTS-Staatsvertrags wurde zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingeleitet. Damit zeigt das BMDS, dass der Bürokratieabbau kein Lippenbekenntnis ist. Wenn das NOOTS greift, könnten sich endlich zigfach redundante Formulare erübrigen – ein Befreiungsschlag für genervte Bürger und Unternehmen. Allerdings: Noch ist das Zukunftsmusik, denn Bund und Länder müssen das System tatsächlich mit ihren „Datentöpfen“ füttern. Immerhin, der Startschuss fiel innerhalb der 100-Tage-Frist.
- KI und digitale Wirtschaft: Ein weiterer Akzent ist die Förderung von Künstlicher Intelligenz und tech-freundlichen Rahmenbedingungen. Am 3. Juli wurde der KI-Service-Desk bei der Bundesnetzagentur gelauncht. Dieses neue Beratungsportal richtet sich vor allem an Mittelstand und Startups und bietet praxisnahe Infos zur kommenden EU-KI-Regulierung (AI Act) – darunter einen „Compliance-Kompass“ für Unternehmen. Firmen können so prüfen, ob und welche EU-Vorgaben für ihre KI-Systeme gelten. Wildberger will die Seite als Signal verstanden wissen, „wie wir uns eine nationale KI-Aufsicht vorstellen: wirtschafts- und innovationsfreundlich, mit schlanken, schnellen Strukturen“. Dieser Ansatz darf durchaus positiv aufgenommen werden, zeigt er doch, dass die Regierung bei Zukunftstechnologien nicht nur warnen, sondern konkret unterstützen will.
- Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau: Vielleicht am schwierigsten ist Wildbergers Mission, den Beamtenapparat zu entrümpeln. Hier hat das BMDS zunächst die nötigen Strukturen geschaffen. Ende Juli richtete die Regierung den neuen Staatssekretärs-Ausschuss „Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau“ ein, angesiedelt beim BMDS. Geleitet vom parlamentarischen Staatssekretär Philipp Amthor (CDU), versammelt dieser Ausschuss ranghohe Vertreter aller Ministerien und des Kanzleramts, um gemeinsam die überfällige Verwaltungsreform anzuschieben. Amthor fand klare Worte: Bürger und Wirtschaft erwarteten zu Recht, „dass wir Deutschland wieder leistungsfähig machen, indem wir Ballast abwerfen“ – genug der Ankündigungen, jetzt zählten „Taten und messbare Erfolge“, ließ er sich in der hauseigenen Pressemitteilung zitieren. Die Agenda ist lang: Überflüssige Bundesbehörden sollen zusammengelegt werden, Berichtspflichten der Wirtschaft reduziert, für jedes neue Gesetz ein Praxis- und Digitaltauglichkeits-Check durchgeführt werden. Kurz: Bürokratie soll systematisch auf Diät gesetzt werden. Dass ausgerechnet ein konservativer CDUler wie Amthor die Aufgabe übernimmt, überrascht. Aber vielleicht braucht es diese Provokation. In den ersten 100 Tagen blieb es hier noch bei Vorbereitungen auf Arbeitsebene (der Ausschuss nahm seine Arbeit ja gerade erst auf). Doch immerhin, die Koordination steht. Notwendig, denn die siloverliebte Bürokratie kann nur gemeinsam gebändigt werden.
- Teamaufbau und Start-up-Mentalität: Nicht zu vergessen: Wildberger hat in Rekordzeit ein neues Ministerium aus dem Boden gestampft, was erstmals seit 1986 der Fall war. Davor muss man den Hut ziehen. Hunderte Beamte wurden aus diversen Ressorts zusammengezogen. Anfangs herrschte Improvisation à la Start-up – vom Flohmarkt-Porzellan bis zur mitgebrachten Kaffeemaschine. Wildberger rühmte eine „Start-up-Mentalität“ in seinem Haus. Tatsächlich stand schon im Juni ein erster Organigramm-Entwurf fürs BMDS, im August folgte das finale Organigramm. Die darin verbriefte personelle Aufstellung signalisiert: Hier soll – so das im Politikbetrieb eben möglich ist – Tempo gemacht werden, ohne lange Einarbeitung. Und Wildberger selbst? Der Quereinsteiger aus der Wirtschaft hat sich schnell in der Berliner Politik akklimatisiert. Seine Antrittsrede blieb zwar eher vage und risikoscheu, doch in Interviews zeigt er Klartext: „Sehe ich ein Faxgerät, fliegt es raus“, polterte er im Juli. Natürlich ersetzen flotte Ansagen noch keine Reform, aber sie markieren einen Kulturwandel weg von Behördentrott hin zu moderner Denkweise.
Zusammengenommen hat Wildberger in 100 Tagen ein ordentliches Pflichtenheft abgearbeitet: Netzinfrastruktur priorisiert, Verwaltungsdatenaustausch aufgegleist, KI-Regulierung vorbereitet, eine Regierungskommission für Bürokratieabbau installiert und das Ministerium funktionsfähig gemacht. Das ist ordentlich Substanz. Dennoch darf man nicht übersehen: Vieles steckt noch in der Startphase. Gesetze mögen beschlossen sein – bis Glasfaser wirklich überall liegt, bis Bürger tatsächlich nur einmal Daten eingeben müssen, bis Ämter keine Faxe mehr nutzen, wird es dauern. Wildberger hat den Tanker auf Kurs gebracht, aber der Hafen ist noch weit entfernt.
Was noch fehlt: Noch mehr Macher-Mentalität
Die digitale Wirtschaft – von Startups über Mittelstand bis Großkonzerne – schaut genau hin, ob die Politik ihre Versprechen einlöst. Nach 100 Tagen bleiben Wünsche wie diese beispielhaften offen:
- Spürbarer Bürokratieabbau: Die Ankündigungen sind da, aber spürbare Erleichterungen fehlen bislang. Die Wirtschaft erwartet hier rasch konkrete Entlastungen – weniger Berichts- und Doku-Pflichten, schnellere Genehmigungen, One-Stop-Shops für Amtswege. Die „Modernisierungsagenda“ steht zwar, aber nun müssen sehr bald Taten folgen. Wildberger selbst schätzt, im aktuellen Tempo bräuchte man noch fünf Jahre für 100 Prozent. Mal sehen, wie lange der Geduldsfaden tatsächlich halten muss.
- Klare Abgrenzung der Kompetenzen des Digitalressorts: Für Unruhe sorgt ein Kompetenzgerangel innerhalb der Regierung. Neben Wildberger gibt es nämlich noch Dorothee Bär (CSU), Chefin des neuen Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Ihre Zuständigkeiten überschneiden sich in Teilen mit Wildbergers Portfolio (Stichwort KI-Förderung, Innovationspolitik). Es braucht eine schnelle Klärung: Wer ist wofür federführend? Das Digitalministerium ist als Querschnittsfunktion organisiert, hat aber nur begrenzte Durchsetzungsmacht. Per se darf das BMDS nicht als Feigenblatt für andere Ministerien gelten; es bleibt der Bedarf an Digitalisierung über Ressortgrenzen hinweg. Aber es darf nicht passieren, dass zum Beispiel beim Thema KI Bärs Hightech-Ministerium eine Strategie erarbeitet, während Wildberger parallel eine eigene Linie fährt – oder Reiche digitalpolitische Akzente im Wirtschaftsressort setzt, ohne Abstimmung mit dem BMDS. Deutschland kann sich keinen Kompetenz-Wirrwarr leisten.
- Praxisnahe Umsetzung und Kommunikation: Schließlich erwarten die digitalen Unternehmer, dass Wildbergers schöne Pläne auch in der Realität ankommen – und zwar zügig. Der „Digital Check“ für neue Gesetze muss mehr sein als ein Formular im Gesetzgebungsprozess; er muss spürbar verhindern, dass absurde Vorgaben (wie etwa ein E-Mail-Verbot in Amtsstuben, das es tatsächlich gab) überhaupt noch entstehen. Zudem sollte Wildberger sichtbarer mit Erfolgen hausieren gehen. Er muss Erfolgsgeschichten – oder Paukenschläge und Weckrufe – schaffen, um die Stimmung insgesamt zu drehen. Er kommuniziert bereits zeitgemäß und offen, holt die Bürger und andere Stakeholder ins Boot. Das Digitalministerium sollte noch stärker die Öffentlichkeit mobilisieren, um Druck auf Behörden aufzubauen. Die Bürger sind schließlich die wichtigsten Verbündeten. Auch wünscht man sich Fortschritte bei staatlichen Innovationsprojekten – etwa dass Verwaltung selbst KI pilotiert (wie Chatbots für Anfragen) oder Reallabore für neue Tech-Anwendungen schafft, wo Unternehmen und Ämter gemeinsam experimentieren können. Kurz: Der Minister muss von nun an Macher-Mentalität beweisen und greifbare Pilotprojekte liefern, statt sich in Strategiepapieren zu verlieren.
Digitalminister Wildberger: Kein Karrierepolitiker
Die Strategie dafür stimmt: Wildberger konzentrierte sich auf große Hebel (Netze, Daten, KI, Verwaltung) und holte früh Entscheidungskompetenz an sich. Er hat gezeigt, dass er den Koalitionspartner SPD und die Länder(-digitalminister) einbinden kann – sonst wären Gesetzesbeschlüsse in Rekordzeit kaum möglich gewesen. Als Quereinsteiger wirkt Wildberger erfreulich unideologisch und ergebnisorientiert. Seine markigen Sprüche („Fax fliegt raus“) und der betonte Start-up-Spirit unterscheiden ihn wohltuend von Bürokraten, die früher die digitale Agenda geprägt haben.
Dennoch muss man realistisch bleiben: Bisher sind viele Etappensiege vor allem politisch-administrativer Natur – Gesetze, Gremien, Konzepte. Die harte Wahrheit ist, dass für Bürger und Unternehmen im Alltag noch kaum etwas besser geworden ist. Kein Unternehmer hat nach 100 Tagen BMDS weniger Formblätter auf dem Tisch, kein Bürger hat schneller Internet bekommen. Die Umsetzung wird der Lackmustest. Und hier liegt die größte Herausforderung für Wildberger: Kann er den behäbigen Staatsapparat tatsächlich in Bewegung bringen?
Wildberger muss aufpassen, dass sein Tatendrang nicht im System versandet. Die Koalition steht unter Erfolgsdruck und hat – anders als die Ampel zuvor – keine Ausreden mehr, es gäbe Dissens zwischen Partnern. Schwarz-Rot wollte dieses Digitalministerium, nun muss es auch liefern.
Der Digitalminister wird an knallharten KPI gemessen werden: Steigt der Glasfaserausbau-Kurve erkennbar an? Geht die Zahl analoger Behördengänge runter, sind E-Health-Angebote einfach nutzbar? Wird Deutschlands Abschneiden bei internationalen Digital-Rankings besser? Hier darf Wildberger keine Beschönigungen liefern, sondern sollte die Fortschritte – oder deren Ausbleiben – transparent machen. Seine Performance wird letztlich daran gemessen, ob Deutschland zwischen 2025 und 2029 endlich aus dem digitalen Mittelfeld nach vorne kommt.
Die nächsten Monate werden zeigen, ob Wildberger den Übergang von der Planung zur Praxis schafft. Die (Digital-)Wirtschaft sollte ihn dabei lautstark begleiten: Beifall klatschen, wo Erfolge kommen, aber auch kein Pardon kennen, wo Ausreden gemacht werden. Unternehmen wollen spüren, dass Formulare verschwinden, Genehmigungen schneller gehen, digitale Services funktionieren und Innovation belohnt wird. Noch genießt Wildberger einen Startbonus. Aber dieser Bonus ist endlich. Wenn bis zur nächsten Digital-Bilanz etwa nach einem Jahr im Amt keine sichtbaren Fortschritte erkennbar sind, wird die Stimmung kippen.
Unsere Politik braucht das Doppel aus Praxis und Tempo, damit Deutschland seinen Rückstand in digitaler Infrastruktur, Datenökonomie und Verwaltungsdigitalisierung endlich aufholt. Die ersten 100 Tage mit dem lang ersehnten Digitalministerium müssen als respektable Vorbereitung verbucht werden. Ab jetzt zählt es, umzusetzen. Karsten Wildberger ist kein Karrierepolitiker, sondern Manager – und Digitaler. Bleibt zu hoffen, dass sein Einfluss als solcher groß genug ist.